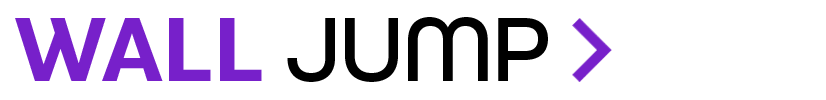Muskelfaserriss lautet die Diagnose. In Schwindel erregender Höhe von Einmeterfünfzig muss ich irgendetwas falsch gemacht haben, als ich mich vom einen Tritt zum nächsten schwingen wollte. Dass der Knall vom Reißen meiner Wade in der ganzen Kletterhalle zu hören gewesen sei, würde ich des Dramas wegen gerne schreiben, wäre aber gelogen. Ein sehr unangenehmes Geräusch hat es dennoch gemacht. Eines, das man nur aus dem Echten Leben kennt und das in Videospielen nicht vorkommt.
Dabei hätten deren Welten genug Projektionsfläche dafür zu bieten. Traversal, also die Bewegung von einem Ort zum nächsten, ist in Spielen so allgegenwärtig wie der eigene Herzschlag. Immer in Bewegung. Auf der Tastatur sind es zwei bis drei Finger, auf einem Controller mindestens ein Daumen, die sich dieser Aufgabe exklusiv widmen – das sind bis zu 50% des gesamten Inputspektrums.
Doch natürlich geht es nicht nur um das Zurücklegen einer Strecke. Gehen, Laufen, Rennen, dabei Hindernissen ausweichen, vielleicht Zielen und Schießen, Lenken, Driften, Posen – das ist die Herausforderung, Teil des Flows, man könnte fast sagen: Das Spiel an sich. Spätestens seit Nathan Drake über kollabierende Böden und abstürzende Altbauten halb hinfort schwebt geht die Bewegung über alle drei Achsen des Raumes der Spielwelt. Von links nach rechts, von vorne nach hinten und von unten nach oben.
Ausgerechnet aber beim Vertikalen, bei der schwierigsten Variante der Fortbewegung, landen die meisten Gamedesignideen in einem mittelgroßen Vakuum. Der Spielfluss stoppt, die Herausforderung reduziert sich auf ein Minimum. Drücke „nach vorn“ um oben anzukommen. An hübsch angemalten Kanten hangelt und überspringt der Avatar mühelos mehrere Längen des eigenen Körpers. Selbst Kletterolympioniken können davon nur träumen.
Sportliche Fitness ist für die bewegte Figur meist eine unendliche Ressource. Klar kann die Kondition auch mal ausgehen, aber entweder wird sie durch kurze Pausen, Essen, Schmerzmittel oder Cutscenes wieder hergestellt. Unsere Helden haben übermenschliche Fähigkeiten, was als Teil der Heldenfantasie auch recht und billig ist. Äußere Einflüsse wie Hindernisse oder Geschosse setzen ihnen fühlbar zu, aber Momente, in denen der Körper wegen der Belastung einfach mal „Nö“ sagt und innerlich verwundet streikt, bleiben vollständig aus. Maximal verlieren sie beim Scheitern ein paar Herzen, aber die Fähigkeiten bleiben erhalten und sie können es erneut versuchen, mit voller Kraft gen Gipfel.
Natürlich wünsche ich mir nicht, dass Lara oder Link bei der nächsten Kletterpartie Krämpfe und Sportunfälle befürchten müssen. Aber ein digitales Äquivalent zur Herausforderung, achtzig Kilogramm Lebendgewicht ein paar Meter vom Boden weg zu bewegen, gibt es selten bis nie. Dabei hätte eine solche Mechanik vielleicht ihren ganz eigenen Reiz, Klettersportler:innen wissen hier, wovon sie reden. Das Haushalten mit der eigenen Kondition und Kraft, das strategische Planen und Ausführen von Bewegungen, die Spannung des Risikos – all das macht das Kraxeln an Wänden und anderen vertikalen Objekten ja erst so reizvoll. Klettern ist Körper- und Kopfsache. Geräusche wie das Reißen einer Muskelfaser könnte dabei sogar Teil des Feedback-Loops werden. Wenn wir brechende Knochen, schmetternde Schwerter und explodierende Schädel ertragen, dann auch das. Nur der anschließende Krankenhausbesuch und die wochenlange Physiotherapie passen womöglich nicht mehr zum Gameplay. Da sind wir wohl frühestens, wenn auch PTSD-Therapiesitzungen zum Standard in Call of Duty geworden sind.
Spiele, in denen viel geklettert wird, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Über die Qualität einer Ladezeit kommen zum Beispiel nicht hinaus: Assain’s Creed, Uncharted, Tomb Raider (2013), Horizon: Zero Dawn oder God of War. Etwas besser gelöst haben das mutmaßlich Mirror’s Edge, Celeste, Zelda: Breath of the Wild, Tomb Raider (1996) oder Spiele von Bennet Foddy.
This post is also available in:
![]() Englisch
Englisch