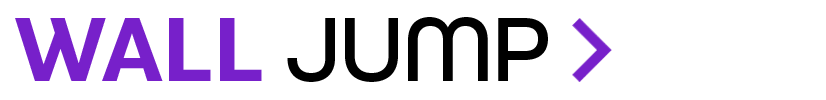Okay, lasst mich dem Elefanten im Raum direkt zu Anfang einen Namen geben: Death Stranding ist vielleicht ein sehr gutes Spiel. Oder ein sehr schlechtes. Oder vielleicht ist es gar kein Spiel. Ich kann mich auch nach zwanzig Stunden Spielzeit noch nicht mit mir selbst einigen. Das liegt vielleicht daran, dass das Open-World-Game zu ein großem Teil im Mikrokosmos der Menüs und Interfaces stattfindet.
Death Strandings Bedienoberflächen machen mich fertig. Sie sind ein Sensory Overload an einem raketenfreien Silvesterhimmel. Ein Kaleidoskop der Selektionsparalyse. Ich könnte Stunden mit ihnen verbringen und am Ende nicht rekapitulieren, ob sie vergnüglich oder Folter waren.
Kurz zur Einordnung: Bedienoberflächen / Interfaces sind alles, was keine Figur, Spielobjekt oder Gamewelt ist. Menüs, Knöpfe, Texte, Statusleisten, Auswahllisten, nochmal Knöpfe, Heads-Up-Displays etc. Klar soweit? Dann weiter.
Kojimas Leidenschaft für „digital authentisches“ Interface-Design hat sich schon früh abgezeichnet. Als Microsoft uns mit WordArt quälte und sich viel zu viele „Grafikdesigner“ in die bevel-and-emboss-Funktion von Photoshop verliebten, zeigte Hideo bereits 1997 in Metal Gear Solid seinen nüchternen, farbarmen, ikonischen Stil. Klare Linien, Geometrie, exemplarische Symbole, kein Gramm Fett an einer Auswahlbox. Metal Gear Solids Item- und Waffenauswahl war puristisch, fast futuristisch für die damalige Zeit. Im Vergleich zu anderen verspielten, dekorativen Anzeigeelementen wirkten sie fast ein bisschen unfertig. Als ob sie noch Platzhalter aus einer reinen Entwickler-Version wären, als ob ich mit einem kalten Computer kommunizieren würde. Und gerade das tat der Sache enorm gut, denn sie waren klar, eindeutig und, aller Kryptik zum trotz, lesbar.

Klugscheißer wie ich wissen, dass der Skeuomorphismus (die Kunst, Elemente in Anlehnung an real existierende Objekte zu gestalten), wie ihn andere Designer:innen anwenden, schon ganz nützlich sein kann. Ein Button, der auch tatsächlich ein bisschen aussieht wie ein Schalter, braucht keine Erläuterung dazu, wie ich ihn nutzen kann. Eine Fläche, die aussieht wie Papier, lädt zum drauf Schreiben oder Lesen ein. Ob etwas interaktiv ist oder nicht, kann ich anhand der Form, des Schattenwurfs oder des farblichen Kontrasts erkennen. Wenn mein Manareservoir tatsächlich aussieht wie eine Flüssigkeit in einem Glasbehälter, kann sich das wunderbar in den Stil der Welt einfügen. Auch heute lassen es sich viele Spiele nicht nehmen, Cursor und Mauszeiger so zu gestalten, dass sie einen Zauberstab, eine Hand oder irgendwas „echtes“ aus der Spielwelt imitieren. Wie eine passend gewählte Schriftart zahlt sowas auf die Lesbarkeit und Verbundenheit mit dem Spiel ein.
Ob das dem weirden Geist Kojimas wohl zu mainstreamig war? Jedenfalls bleibt sein Stil ein unverwechselbares Kontrastprogramm zum gängigen Standard, der sich erst im Laufe der digitalen Revolution in den letzten Jahren etwas mehr dem Purismus genähert hat. Dass das Prinzip trotzdem schon seit Jahrzehnten gut funktioniert, ist einem entscheidenden Designaspekt zu verdanken: Feedback.
Wer Shooter spielt, kann ganz ohne Erklärung erkennen, ob eine Waffe kraftvoll und grob oder präzise und zierlich wirkt. Animation und Sound verbinden sich zu einem Gefühl, bei dem wir meinen, den Rückstoß in den Händen spüren zu können. In Interfaces ist das nicht anders. Eine Eingabe kann sich schwerfällig und wichtig anfühlen oder fix und nebensächlich. In Death Stranding findet diese Design-Philosophie ihren bislang konsequentesten Einsatz. Das Interface blinkt und pulsiert nicht nur, es piepst und surrt und gibt Rückmeldung. Es zelebriert sein Dasein minutenlang bei jeder Gelegenheit. Zum Ende einer Liefermission erscheint Screen um Screen, blenden sich Statistiken ein, zählen Nummern hoch, füllen sich Balken und Diagramme. Mal automatisch, mal auf Knopfdruck. Sie zucken und wabern dabei, als tanzten sie zur Freude, am Leben zu sein. Und unsere Synapsen tanzen mit.
Keines dieser Elemente ähnelt dabei einem echten Ding, einer Sache, die man in die Hand nehmen könnte. Sie können nur im Digitalen existieren. Keine abgerundeten Ecken, wie wir sie von Smartphones kennen, oder Töne, die uns an Geräusche aus dem Alltag erinnern, weichen die Simulation auf. Es ist authentisch auf seine ganz eigene Weise und spricht eine Sprache, die manche bereits lange verstehen, andere erst lernen müssen.

Das ist zuweilen zu viel. So viel mehr als diese karge Landschaft, durch die ich Sam Porter Bridges bewege, so dass ich zu dem Schluss kommen muss, dass hier das eigentliche Game versteckt ist. Komplexe Dinge zu begreifen macht Spaß, denn man kann bei jeder Begegnung etwas neues entdecken. Ich erinnere mich, wie ich als Kind begann, die Stereoanlage meiner Eltern zu verstehen. Nicht jeder Knopf war dabei gleich wichtig, manche führten sofort zu einem Resultat (mach leiser!), andere erst mit etwas Übung. Und bis heute bleibt es je nach Setup ein Ratespiel, was diese „Aux“-Einstellung wohl anstellt.
Ich glaube und hoffe nicht, dass sich unsere alltäglichen Oberflächen irgendwann alle so anfühlen. Vielleicht aber, wenn die Zahl der Digital Natives irgendwann die der Boomer und Millennials übersteigt und Augmented-Reality-Kontaktlinsen Standard werden, passiert das doch. Nun. Wenn das dann so sein muss, wünsche ich mir, dass es Bedienoberflächen im Geiste Kojimas sind (und mit Controller geliefert werden).
Death Stranding ist ein Lieferjungensimulator mit Norman Reedus in der Hauptrolle, entwickelt von seinem Best Bro Game Designer Hideo Kojima, der das Game ganz ohne Konami im Sommer 2020 mit Kojima Productions auf den Markt brachte. Das ganze spielt sich wie MGS5, nur ohne die spannenden Parts. Irgendwie geht es wieder um die USA, Jenseits-Babys und Brückenbau in der Postapokalypse. Aber eigentlich ist das Setting nur Hintergrundrauschen für stundenlange Menünavigationen.
This post is also available in:
![]() Englisch
Englisch