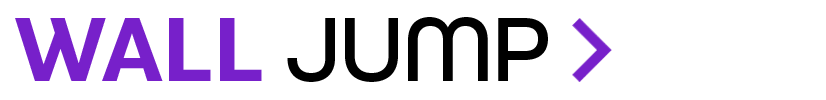Ich bin ein schlechter Verlierer. Egal ob beim Sport, in Diskussionen oder bei Mario Kart – alleine die Aussicht auf eine Niederlage lässt meine Laune rapide sinken. Zu all dem gesellt sich dann gerne noch meine steigende Ungeduld und in der Konsequenz schmeiße ich dann selbst souveräne Siege weg. Eine selbsterfüllende Prophezeiung des Untergangs.
Dem Tod aus dem Weg zu gehen, ist als Gamer allerdings alles andere als einfach. Denn egal, ob man springt, schießt oder Autorennen fährt – das Sterben ist ein doch recht integraler Bestandteil nahezu aller Spiele. Schon im Urvater aller Spiele, Spacewar!, galt es, in einem Raumschiff dem Tod zu entkommen. In den folgenden 60 Jahren haben sich Spiele vom Hinterzimmer des MIT-Instituts zur globalen Unterhaltungsindustrie entwickelt. Der Tod blieb dabei aber immer präsent. Und so bin ich als Super Mario in Abgründe gestürzt, wurde in Call of Duty von vermeintlichen Terroristen erschossen, konnte mich nicht in State of Decay mordlustigen Zombies erwehren oder bin mit 300km/h in Need for Speed gegen die Wand gerast. Und wo es in vielen Spielen noch schlicht und einfach „Game Over“ heißt, brachte es Resident Evil schon immer auf den Punkt: „You are dead.“ – Du bist tot.
Tausende Bildschirmtode später ermüdet mich diese unabhängig vom Genre immer gleiche Erfahrung zunehmend. Denn Sterben ist herabwürdigend, Sterben ist langweilig, Sterben ist frustrierend. Je mehr die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt, umso mehr sehne ich mich nach narrativen Erlebnissen, die mir Entspannung und Ablenkung bieten und mich nicht durch ständige Wiederholungen wahrhaftig tödlicher Spielpassagen die Freude an der Unterhaltung trüben. Und genau aus diesen Gründen hatte ich mich einem Genre, das den Tod ganz zentral ins Zentrum rückt, bisher verwehrt: Roguelites. Ein Genre, das von mir erwartet, in schier unendlichen Versuchen unendlich oft zu sterben? Das klingt für mich wie die Antithese all dessen, das mir an Spielen dieser Tage Spaß macht!
Doch nun ist ein Spiel gekommen, das alles ändern soll. Ein Spiel, das die Kritik zu wahren Lobpreisungen bringt. Ein Spiel, in dem ich nicht nur immerwährend sterbe, sondern das auch noch direkt nach dem Gott des Todes benannt ist: Hades.
Schaffe ich es in Hades, dem Tod ins Gesicht zu blicken – und kann ich dank Hades den Tod als Spiel- und Stilmittel schätzen lernen und endlich ein guter Verlierer werden?
Klar, natürlich hilft es, dass Hades clever ist. Die griechische Unterwelt ist charmant dargestellt und die Dialoge erinnern eher an Geplänkel zwischen englischen Fußball-Hooligans als an die Schriften von Homer. Nach jedem Tod – und das sind tatsächlich sehr schnell sehr viele – lande ich in einer Art Unterwelt-Bahnhof und plaudere mit der verstoßenen Großfamilie, die unmittelbar Bezug auf die mannigfaltige Tragik meines Ablebens nimmt. Das ist launig und schafft eine gewisse, grundsätzliche Leichtigkeit, über mein Versagen hinwegzusehen. Nichtsdestotrotz: Ich bin gestorben, und das oft, und nun muss ich dieselben Gegner wieder besiegen.
Und klar, natürlich hilft es auch, dass ich dabei lerne. Ich beginne zu verstehen, welche Gegner welche Angriffsmuster haben, erspiele mir Gold und Schätze, mit denen ich Upgrades erwerbe, und habe tatsächlich von Tod zu Tod das Gefühl, besser zu werden und nur noch diesen einen, perfekten Versuch zu benötigen, eben doch lebendig aus dem Hades zu entkommen. Nichtsdestotrotz: Bis jetzt sterbe ich weiter, und das oft. Das Spiel bleibt stur: „There is no escape.“ Dem Tod entkommt niemand. Aber reicht mir nicht ein einmaliger Permadeath, bevor ich das Spiel frustriert in die Ecke feuere und auf den Nachfolger „Ambrosia“ warte, mit üppigem Wein-Weib-Gesang-Narrativ und unendlicher Energieleiste? Bevor Alkohol als Problemlöser herangezogen wird, lege ich aber erst einmal die Waffe ab, verziehe mich ins aufgepeppte Schlafgemach der Hauptfigur und frage mich: Was bedeutet der Tod in Videospielen überhaupt?
In der Philosophie ist der Tod vor allem eines: Unbegreiflich. Der allgegenwärtige österreichische Psychoanalytiker Sigmund Freud behauptete sogar, dass jeder Mensch aufgrund dieser Unbegreiflichkeit im Unterbewussten von seiner eigenen Unsterblichkeit überzeugt ist. Vielleicht erklärt das auch, wieso mich eigentlich jeder einzige Tod, den ich virtuell bereits gestorben bin, emotional wenig berührt hat. Schließlich ist der letzte Spielstand stets nur einen Klick entfernt. In überwiegend binären Spielsystemen müssen Spieler oft zwischen zwei Zuständen wählen. Laufen oder Springen. Schlagen oder Blocken. Und eben Leben oder Sterben. Letztendlich geht es dabei aber nicht um Tod – sondern um die Handlungsmacht des Spielers. Und damit ist der Tod also einfach nur eine Metapher, die mir verdeutlicht, wie gut ich das Spiel meistere.
Ein paar weitere Runden Hades bestätigen den theoretischen Exkurs: Durch die vielen schnellen Runs, die ständige Präsenz des Todes, wird er belanglos – und zur Normalität. Mitleid und Trauer haben im Narrativ keinen Platz, denn schließlich plaudere ich ja wenige Sekunden nach meinem Ableben schon wieder mit meinen Widersachern. Und die wahnsinnige Frequenz der einzelnen Runs lässt auch kaum Raum für Langeweile oder Frustration. Denn selbst im Scheitern belohnt mich das Spiel und vermittelt mir in jedem Moment, dass kein zurückgelegter Meter, kein Kampf umsonst waren. Der Tod? Nur Mittel zum Zweck, besser zu verstehen, wo ich mein erlerntes Können noch verfeinern muss. Der Gameplay-Loop von Hades, er hat mich endgültig gepackt.
Vielleicht muss ich anderen Spielen, die das Scheitern des Spielers nicht so eindeutig kodieren, nicht so gut motivieren, nicht so gut zeigen, wo ich schon besser geworden bin, einfach mit mehr Geduld begegnen. Vielleicht sind sie einfach nicht so gute Lehrmeister wie Hades. In jedem Fall sollte ich den Tod in Spielen nicht mehr ausschließlich mit Niederlage gleichsetzen. Denn wie ein in anderer, bedeutender österreichischer Psychoanalytiker (und Sänger) namens Falco schließlich so prägnant fragte: „Muss ich erst sterben, um zu leben?“
Das kalifornische Studio Supergiant Games ist für seine herausragenden Indiespiele bekannt – und hat mit Hades nach Bastion, Transistor und Pyre ihr maßgebliches Werk vorgelegt, dem sich selbst Genre-Verweigerer nicht mehr entziehen konnten.
This post is also available in:
![]() Englisch
Englisch